geheiratet und 1933 wurde ich in Dresden geboren.
Der Name Rataj kommt wohl aus der Gegend Österreich-Ungarn. Die Familie kam wahrscheinlich ursprünglich von der ungarischen Grenze. Mein Großvater väterlicherseits war Justizbeamter in Dresden. Mein Urgroßvater väterlicherseits war königlich-sächsischer Stallmeister, war also schon am Hof und er hat wohl dafür gesorgt, dass mein Großvater auch in den königlichen Dienst kam und Justizbeamter wurde. Dadurch hat mein Vater die Möglichkeit bekommen, in der Hofküche zu lernen, denn damals war es ja so, dass man für die Lehre bezahlen musste. Das war eine ziemlich teure Angelegenheit. Man musste nicht nur eine hohe Bargeldsumme bezahlen, so 5000 Reichsmark, sondern auch das ganze Besteck, die Messer und alles selbst bezahlen. Einiges davon habe ich noch, z. B. meine Fleischgabel in der Küche. Das war alles noch handgearbeitet. Er war mit Leib und Seele Koch.
Mein Urgroßvater ist gestorben als ich 4 Jahre alt war. Ich habe ihn noch kennengelernt. Mein Vater sah ihm sehr ähnlich. Er hatte ja ganz schwarze Haare, blauschwarze Haare. Die hatte mein Urgroßvater auch. Mein Urgroßvater hatte als Gardekürassier angefangen und ist dann Stallmeister des königlichen Gestüts geworden. Das war ein toller Posten. Auch mein Vater war sehr angesehen. Er hat mit dem König Reisen gemacht. Der nahm seinen Leibkoch und seinen Leibjäger mit. Mein Vater erzählte auch von einem General, der mitreiste. Zuerst reisten sie noch mit Kutschen, z. B. nach Italien. Er war auch zu einer Besprechung in Rapallo. Davon hat er mir erzählt. Als ich 1933 geboren wurde, war der König schon tot. Meine Eltern waren nach dem Tod des Königs von Breslau nach Dresden gezogen.
Mein Vater war schon, als er noch für den König kochte, von Offizieren angesprochen worden, die berichteten, dass in Naumburg Kasernen gebaut werden sollten. Sie fragten, ob er nicht die Kantinen und das Offizierskasino dort übernehmen könnte. Sie aßen seine Sachen gerne. Er war so etwas wie ein Sternekoch und er hat auch auf Kochkunstausstellungen Preise gewonnen. Die Kasernen wurden erst 1935 fertig. Bis dahin lebten wir in Dresden und mein Vater fuhr zuerst bei der HAPAG-Lloyd als Schiffskoch auf den kombinierten Passagier-Fracht-Dampfern nach Mittel- und Südamerika. Da war er immer eine ganze Zeit unterwegs, mindestens ein Vierteljahr. Meine Mutter sollte eigentlich als Stewardess mitfahren, konnte dann aber nicht, weil ich ja die Absicht hatte, auf die Welt zu kommen.
Mein Vater arbeitete auch eine Zeit lang bei der Mitropa als Speisewagenkoch bis 1935 die Kasernen in Naumburg fertig waren. Da übernahm er zwei Militärkantinen und ein Offizierskasino. Das war damals eine teure Angelegenheit. Er musste sich schwer in Schulden stürzen. Die Inneneinrichtung war sein Eigentum. Das war ein ganz schöner Batzen Geld. In dem einen Gebäude war oben ein großer Saal mit einem Tresen und Zapfhähnen und unten waren ein ganz großer Saal und ein kleinerer Raum, d.h. es waren da zwei Theken mit je vier Zapfsäulen und im Keller der Kühlraum. Da standen acht Fässer Getränke, verschiedene Biersorten, Pils und Export und dunkles Bier und Apfelbrause. Die schmeckte ausgezeichnet. Die konnte ich als Kind trinken. Und dann gab es die Läden dazu. Da gab es praktisch alles. Ich habe als Kind schon Coca-Cola kennengelernt. Das verkauften wir. Coca-Cola-Flaschen sind ja heute noch so geformt, aber damals waren die Flaschen etwas kleiner und irgendwie schmeckte die Cola anders, sehr viel besser. Sie war nicht so süß wie heute. Ich durfte natürlich nicht immer Coca-Cola trinken. In den großen Verkaufsräumen konntest du von der Nähnadel bis zu Süßwaren und Zigaretten alles kaufen. Wir hatten neun Mann Personal. Mein Vater hatte noch einen Koch und dann mussten die Tresen besetzt sein und meine Mutter herrschte über alles. Sie war die Chefin und Vati stand am Herd.
Die Charaktere meiner Eltern waren sehr verschieden. Meine Mutter war gebürtige Sylterin, also Nordfriesin, aber sehr temperamentvoll. Mein Vater als gebürtiger Dresdner, dessen Vorfahren väterlicherseits aus der Gegend Kroatien-Ungarn kamen, war ein ganz ruhiger Vertreter. Normalerweise sollte man sich das ja umgekehrt vorstellen. Mein Vater konnte sich nur erregen, wenn er bei 68°C am riesigen Herd in der Küche stand. Dann konnte es mal vorkommen, dass er aus der Haut fuhr, aber eigentlich bestimmte meine Mutter das ganze Geschehen. Dazu kam noch, dass mein Vater überaus pünktlich war und meine Mutter das ganze Gegenteil davon. Es war so, dass meine Schwester und ich unser ganzes Leben lang immer superpünktlich waren. Wir waren direkt ängstlich bemüht, pünktlich zu bleiben, weil wir eben auch unsere Erlebnisse hatten.
Meine Mutter musste sich z. B. unbedingt noch, als wir im Zug nach Dresden saßen, eine Zeitung holen. Sie ging also nochmal raus und ich saß allein da. Ich muss so 5 Jahre alt gewesen sein. Der Zug fuhr ab und meine Mutter war noch nicht da. Sie kam dann in Weißenfels ins Abteil. Sie ist im letzten Moment noch auf den Zug aufgesprungen und da man damals noch nicht die durchgehenden Wagen hatte, musste sie bei der nächsten Station aussteigen und das Abteil suchen, in dem die verlorene Tochter saß. Das waren die Gründe, weshalb wir uns bemüht haben, immer pünktlich zu sein. Das war auch für Birgit ein reiner Angstzustand - auch heutzutage noch. Das steckte uns im Blut.
Der Duft von Heckenrosen
Ich fuhr im Sommer - nicht jedes Jahr - das ging nicht, aber das erste Mal mit zweieinhalb Jahren und das letzte Mal vor dem Krieg 1939, nach Sylt zu meinen Großeltern mütterlicherseits. Nach Sylt zu kommen war nicht so einfach damals. Man war eine ganze Reihe von Stunden unterwegs mit der Bahn mit x-mal Umsteigen. Mit einem kleinen Kind hat man das nicht so gerne gemacht. Das waren für mich große Erlebnisse, da lernte ich eigentlich meine "Heimat" kennen. Groß geworden bin ich ja in Mitteldeutschland. Meine anderen Schulferien habe ich in Dresden verbracht bei meinen Dresdner Großeltern, aber Heimat war Sylt. Mir ging das schon so, wenn wir den Nord-Ostsee-Kanal überquert haben und ich sah die Warften liegen mit den Bauernhäusern drauf. Da lebte ich auf. Das war für mich zu Hause. Und wenn man dann auf Sylt aus dem Bahnhof kam, da hatte man den Duft der Heckenrosen schon am Bahnhof in der Nase. […]
Es war eine sehr schöne Zeit auf Sylt. Was mir in der Nase geblieben ist und was ich heute vermisse, das war der Duft der Heckenrosen. Die Dünenränder waren auf der Ostseite vollkommen bewachsen mit Rosen. Es war einfach ein zauberhafter Duft. Wir konnten ja die Dünen damals noch betreten. Also wurden Blaubeeren gesammelt und Kronsbeeren. Das haben wir allerdings auch nach dem Krieg noch gemacht. Da kannte man die Stellen. Später habe ich einige Stellen auch durch meinen Schwiegervater kennengelernt. Er kannte das wiederum durch seine Eltern, denn sein Vater hatte das Jagdgebiet von Westerland nach Hörnum gepachtet. Damals wurden ja auch noch Möweneier gesammelt, was man heute ruhig wieder tun könnte, denn die nehmen ja überhand. In einem friesischen Buch aus den 30er Jahren, das wir gerade lesen, steht ein Bericht darüber, dass es hier auch "einige" Möwen gibt, dass man aber vorsichtig sein müsse, damit die Population nicht gefährdet wird. In den 30er Jahren wurde die Anzahl der Möwen geringer und man durfte keine Eier mehr sammeln.
Bei Kriegsbeginn wurde die Insel gesperrt für Besucher. Dann konnten nicht einmal mehr Kinder zu ihren Eltern, wenn sie irgendwo anders wohnten. Hier war die Einreise nur gestattet für die, die tatsächlich hier gelebt haben. Das war natürlich hart. Wir waren 1939 das letzte Mal auf der Insel. Da war noch kein Krieg. Aber wir mussten vorzeitig wieder abreisen. Wir sind ja immer im Sommer gefahren. Da haben wir uns noch mit der ganzen Verwandtschaft getroffen. […] Es waren viele Künstler auf der Insel und es gab tolle Konzerte. Das war damals ein ganz anderes Publikum hier. Da haben wir auch Hermann Göring gesehen. Der hatte in Wenningstedt ein ganzes Stück Strand für sich abgesperrt. Man konnte am Wasser langlaufen, aber man durfte sich nicht am Strand aufhalten. Das Haus gehörte seiner Frau Emmi Sonnemann, der Schauspielerin. Man hatte ja immer gehört, dass er Jagdflieger war und von seinem Aufstieg und nun kam er von oben die Düne herunter in seinem rot-weiß-gestreiften Badeanzug. Wir liefen am Wasser entlang und er war damals schon recht fett und ich habe mich wohl laut darüber geäußert. Mir wurde dann gesagt, dass ich mal lieber ruhig sein sollte.
Nach dem Krieg sind wir das erste Mal 1946 wieder auf die Insel gekommen. […] Als wir auf die Insel kamen, musste Mutti in Niebüll aussteigen und eine Bescheinigung ausfüllen, sozusagen eine Erlaubnis, damit wir rüberfahren durften, denn hier war ja besetzt von Belgiern und Engländern. Sie hat uns damals 6 oder 8 Wochen hiergelassen und ist wieder nach Hause gefahren. […]
Bei den Großeltern in Dresden
Ich war jedes Jahr in Dresden bei meinen Großeltern. Als ich später zur Schule ging, konnte ich auch Freundinnen mitnehmen. Heinz´ Schwester Marianne war einmal mit und meine Freundin Erika; für die war das herrlich. Sie erzählt heute noch, wenn wir am Telefon klönen: "Weißt du noch, wie wir auf der großen Elbbrücke standen und von oben ins Wasser gespuckt haben?" Ich habe ihr Dresden gezeigt. Ich bin mit ihr in den Zwingerhof gegangen und da haben wir unsere Füße im Zwingerteich baumeln lassen. Ich habe ihr das Nymphenbad gezeigt. Ich habe sehr viele schöne Stunden in Dresden bei meinen Großeltern verbracht. Mein Großvater war ein recht nachgiebiger, sanfter Mann. Auch als Justizbeamter im Zuchthaus blieb er ein guter Mensch. Er sang im Dresdner Staatsopernchor und hat auch als Statist bei der Oper gearbeitet. Damals sagte man noch nicht Semperoper. Das war eben die Oper und die Oper liebte er. So kamen wir an Karten und ich habe schon als vierjährige "Hänsel und Gretel" in der Dresdner Staatsoper gesehen. Meine Großeltern wohnten am Jägerhof in einem Gebäude für Angehörige der sächsischen Verwaltung direkt neben dem sächsischen Heimatmuseum. Heute heißt es Volkskundemuseum. Das ist in der gleichen Straße wie die sächsische Landesregierung, die Staatskanzlei. Meine Großeltern waren mit dem Museumsdirektor befreundet, ich nannte den Onkel und konnte immer dorthin und im Museum spielen. In der Mitte stand die Riesenpyramide und es gab ein ganzes Bergwerk, ein Silberbergwerk, das man anstellen konnte und dann konnte man sehen, wie im Bergwerk gearbeitet wurde. Ich habe auch mit Begeisterung das Elbufer in der Neustadt als mein Eigentum empfunden. Da gab es den Steingarten und den Rosengarten. Das war ganz wunderschön. Heute sind dort nur noch Wiesen.
Mein Urgroßvater wohnte am Zwingerteich. In den letzten Jahren brachte meine Großmutter regelmäßig das Essen dorthin und ich begleitete sie. Anschließend waren wir dann im Zwinger und ich konnte mir jede Ecke dort angucken. Mein Großvater musste arbeiten, aber mit meiner Großmutter habe ich Ausflüge gemacht. Wir fuhren mit der weißen Flotte, mit dem Raddampfer die Elbe rauf nach Rathen bis zur tschechischen Grenze. Da fanden früher die Karl-May-Festspiele statt. Am Amselsee wurde der "Schatz im Silbersee" gespielt. Ich hatte in Dresden auf dem Zwingerteich rudern gelernt und ich habe auch auf dem Amselsee gerudert. Wir waren auf der Bastei. Ich finde, die sächsische Schweiz ist eine der schönsten Landschaften, die man sich vorstellen kann. Wir haben dort viele Wanderungen gemacht. […]
Mein Großvater hatte einen wunderbaren Schrebergarten. Das vergesse ich nie. Den Anblick habe ich heute noch vor Augen. Ein Teil der Laube war mit Teer abgedeckt und der andere Teil war umrankt von allem möglichen, z. B. auch von diesen rotblühenden Feuerbohnen. Das war wunderbar. Ich hatte meine Schildkröte da, meine Hakila, die eigentlich Hansi hieß. Mein Vater brachte sie mir von einer Reise nach Westindien mit. Hansi hatte eine rote Schleife um seinen Panzer und ein langes Band und lief frei im Garten herum. Durch die Schleife und das lange Band konnten wir ihn immer sehen. Es gab einen Gang, der war mit hellem Kies bestreut und Rabatten. Großvater hatte Stachelbeerbäumchen und Johannisbeerbüsche immer versetzt. Johannisbeeren gab es in sämtlichen Farben und Kirschbäume, auch weiße Kirschen, Knubber und Sauerkirschen, Pfirsiche, zwei Quittenbäume, einen Birnenquittenbaum, einen Apfelbaum und auch Pflaumen und Reneclauden. Das war ein ganz schön großer Garten. Meine Großeltern konnten sich praktisch vom Garten ernähren. Mein Vater hat fürs Offizierskasino eingeweckte Sachen bekommen, große Einmachgläser mit Quitten, Kirschen und Mirabellen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie sie das nach Naumburg gekriegt haben. Irgendwie ist es angekommen und wurde bei uns gegessen. Auf den Rabatten waren immer Blumen. Es blühte immer etwas, fast das ganze Jahr über. Es gab Nelken und kleine Astern und Ringelblumen. Der Garten war nicht weit vom Haus. Man musste, um zum Eingang zu kommen, das ganze Schrebergartengebiet umrunden. Eigentlich hätten wir bloß über einen Zaun springen müssen, aber das Gelände war hoch eingezäunt. Wenn man den hinteren Eingang benutzte, war rechts das Winterzelt des Zirkus Sarrasani. Da waren auch die Raubtierhäuser. Von der Seite kamen ab und zu kräftige Gerüche.
Eine Kindheit in der Kaserne
Am schönsten war es 1937 oder 38. Direkt hinter dem Haus, wo wir wohnten und wo auch die Kantinen waren, wurde ein Schwimmbad gebaut. Das war eigentlich ein Feuerlöschteich, weil man wahrscheinlich mit Krieg gerechnet hat und mit Fliegerangriffen, damit immer Wasser vorhanden war. Es gab einen kleinen Sprungturm und ein Floß darauf, damit konnte man rudern. Ich habe dort mit 5 oder 6 Jahren schwimmen gelernt. Das war natürlich auch ein Anziehungspunkt. Als ich zur Schule ging, kamen meine Freundinnen von Naumburg rauf. Die Kasernen waren 3 oder 4 km von der Stadt entfernt. Man musste einen Berg hinaufsteigen. Tante Laurette, die Cousine meiner Mutter, war oft bei uns und sagte mal, es sei kein Wunder, dass ich Rheuma gekriegt hätte, in diesen kalten feuchten Häusern. Mir kam das nicht so vor, aber sie meinte, sie hätte mich immer bedauert, weil es so kalt bei uns gewesen wäre. Also ich fand die Zeit herrlich. Sicher waren es große Räume, aber es gab ja eine Heizung. Vielleicht waren die Heizkörper nicht immer angestellt. Das ist möglich. Meine Mutter holte als Kindermädchen für mich eine Sylterin und auch als Personal. Wir hatten eigentlich immer Sylter Mädchen bei uns und auch Mädchen aus den Dörfern in der Nachbarschaft.
Ich war ein freies Leben gewöhnt und auch ein selbständiges. Mir blieb ja gar nichts anderes übrig. Wenn du Eltern hast, die sich gerade eine Zukunft aufbauen, dann bist du auf dich alleine gestellt, was ich nie als Nachteil empfunden habe. Man hat mich ab und zu mal vergessen. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Ich habe gedacht, guck dir das mal an und sag mal nichts. Also eingeschlafen bin ich nie in den Ecken, in denen ich saß, bis um 10 Uhr einem plötzlich einfiel: Ach Gott, das Kind, wo ist das Kind? Entweder saß ich bei meinem Vater in der Küche und hab mir das angeguckt oder ich saß unten im Laden. Da habe ich mich still in eine Ecke verzogen und wenn da rundherum die Tresen sind, ist man gut versteckt. Ich habe natürlich auch einiges mitgekriegt, was ich nicht unbedingt hätte hören sollen, denn unsere Mädchen waren meistens ganz hübsch. Die wurden ja auch immer geheiratet. Wir brauchten andauernd neue.
Krieg und Nationalsozialismus
Ich bin in einer Kaserne unter Soldaten groß geworden. Das war das Infanterieregiment 53 und die mussten bei Kriegsbeginn 1939 natürlich einrücken. Die Soldaten zogen nach und nach ab, nicht alle auf einmal. Aber die verschiedenen Regimenter zogen ab. Ein Kasernengelände ist ja unwahrscheinlich groß. Das war richtig wie eine kleine Stadt und nach dem ersten Jahr waren die Soldaten fast alle weg und dann wurde es Reservelazarett. Das heißt die Verwundeten kamen und da kriegt man viel mit. Zumindest weißt du dann, wie das ist - auch als Kind - wenn diejenigen, die als Soldaten fröhlich ausziehen, wenn die dann praktisch als Krüppel zurückkommen. Das taten die meisten, die dort waren. Denen fehlte entweder ein Arm oder ein Bein oder auch mal beide Beine. Das waren keine Fälle, die sofort wieder entlassen wurden, sondern das waren Leute, die z. T. jahrelang dort blieben. Die Kantinen waren immer noch da, das Offizierskasino natürlich nicht mehr. Später wurde noch extra ein Offizierskasino gebaut. Das steht heute noch und ist jetzt ein Wohnhaus. Es wurde mitten im Wald gebaut, nicht mehr auf unserem Kasernengelände und mein Vater hat das auch nicht bewirtschaftet. Er hätte das machen können, aber er wurde dann selber eingezogen. Wir hatten nur noch Kantinenbetrieb Verkauf und Ausschank. Die Soldaten wurden nicht durch meinen Vater bekocht. Hauptsächlich hat meine Mutter den Betrieb geleitet. Mein Vater war in Naumburg stationiert. Er hatte dieses russische Gefangenenkommando und er brachte, wenn er kam, immer 2 oder 3 Russen mit. Er wechselte ab, so dass jeder mal rauf kam, damit die dann bei uns verpflegt wurden und in der Kantine mithelfen konnten. Man hat es ihm nicht direkt verboten, aber gern gesehen wurde das nicht.
Von der Verfolgung der Juden habe ich nicht so viel mitgekriegt. Bei uns wurde kein Unterschied gemacht. Es wurde nicht gesagt, das sind Juden oder so etwas. Den Ausdruck habe ich nie gehört. Es gab wohl auch nicht viele jüdische Familien in Naumburg. Naumburg war eine Garnisonsstadt und eine Kleinstadt. Es gab ein jüdisches Geschäft, aber denen ist eigentlich nichts passiert. Ich hatte das Gefühl, dass da jemand seine Hand drüber gehalten hat. Ich weiß aber noch, als ich 1938 gerade in Dresden war, ging meine Großmutter mit mir über die Brücke zum Schloss in der Altstadt. Dort standen wir dann vor den Trümmern der Dresdner Synagoge und da hat meine Großmutter gesagt: " Das musst du dir angucken und das darfst du nie vergessen." Weiter haben wir darüber nicht gesprochen. Sie war sehr ernst dabei. Und dann sind wir wieder zurück gegangen.
In der Schule habe ich auch Glück gehabt. Wir hatten eine alte Lehrerin, Fräulein Henning, die hat nie über Rassenlehre gesprochen. Sie war unsere Klassenlehrerin auf der Volksschule und später auf dem Lyzeum waren die Lehrer alle weg. Wir hatten nur alte Damen, alte Professorinnen, die hatten ihre eigenen Gedanken, aber nicht solche. Da war keine Nazisse dabei.
Als Jungmädchen wurde ich zum BDM eingezogen. Da mussten wir alle hin und da habe ich ein paar Mal Dienst mitgemacht. Das hat mein Vater mal mit einigen Bekannten - einer war bei der Gestapo - mitgekriegt. Die saßen oben beim eisernen Wenzel, das war ein Freund meines Vaters, auf dem Balkon und der hatte den Ausblick auf die Vogelwiese. Und auf der Vogelwiese hatten wir am Sonnabendnachmittag Dienst und mussten bei glühender Sonne und großer Hitze marschieren. Das haben sich die Männer angeguckt und dann sagte einer zu meinem Vater, er sollte mich raufholen, ich würde mich ja halbtot schwitzen. Aber mein Vater meinte, ich solle mal ruhig marschieren, sonst würde ich Ärger kriegen. Hinterher haben sie mir nahegelegt, dass ich den Dienst ja auch in Flemmingen machen könnte. Das war viel näher. Die hatten auch eine Jungmädchengruppe. So bin ich von Naumburg weggekommen. In Flemmingen haben wir eigentlich nur Sport gemacht und gebastelt. Da wurde nicht mehr marschiert. Wir hatten den Sportplatz direkt dabei und es gab jedes Jahr ein Sportfest. Dafür musste man das ganze Jahr trainieren, damit man das gut machte und wir waren gut. Wir waren sehr gut. Wir haben auch sehr viel trainiert. Dann mussten wir für die Winterhilfe basteln. Wir haben sehr viele Holzarbeiten gemacht, mit der Laubsäge gearbeitet, ausgeschnitten und alles Mögliche zusammengebaut. Das wurde eingesammelt und für die Winterhilfe verkauft. Wir haben auch Pulswärmer gestrickt und den Soldaten in Feldpostpäckchen geschickt. Aber marschiert? Ich weiß nicht, ob ich Flemmingen auch nur einen Tag marschiert bin. Wir haben viel gesungen und zur Sonnenwende gab es die großen Jugendweihefeiern. Da sind wir auch mitgezogen. Das ist ganz klar. Das war immer sehr schön feierlich. In Buchholz gab es einen freien Platz. Da wurden rundherum Fackeln abgesteckt und da war das ganze Jungvolk versammelt. Da wurden dann allerdings Fahnen gehisst und markige Reden gehalten, die wir uns anhörten. "Deutschland, Deutschland über alles" und das Horst-Wessel-Lied wurden gesungen.
Ich habe ein freies Leben, aber auch ein abgeschirmtes gehabt. Wir wohnten ja immer außerhalb. Wir hatten allerdings viele Freunde in der Stadt. Wenn wir zusammenkamen, wurden die Kinder immer mitgenommen. Es gab wunderbare Feiern und wir gingen dann irgendwo dort in die Betten und wurden schlafen gelegt. Am nächsten Tag wurden wir wieder nach Hause gebracht. Das war rundum so, wo man sich gerade traf. Die Kinderschar war immer dabei. Das war ein sehr schönes, freies, aber auch sehr behütetes Leben.
Meine Großeltern konnte ich die ganze Zeit weiter in Dresden besuchen. Das letzte Mal war ich im Winter 1944 auf dem Striezlmarkt, das war einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Welt. Dort gab es die Stollen, für die Dresden so berühmt war und die Schnitzereien aus dem Erzgebirge wurden verkauft. Am 14. Februar 1945 wurde Dresden dann bombardiert und ein paar Tage später waren meine Großeltern bei uns. Von da an haben sie bei uns gelebt. Sie hatten unter der Augustusbrücke überlebt. Ihr Haus ist nicht von einer Bombe getroffen worden, es war ausgebrannt. In dieser Nacht ist meine ganze Dresdner Verwandtschaft ausgebombt worden. Meine Mutter lag mit meiner Schwiegermutter meistens etwas quer. Sie meinte, die beiden hätten ja noch etwas rausholen können. Aber die beiden alten Leute hatten versucht, sich vor den Flammen zu schützen und hatten - weiß Gott - anderes zu tun, als in der Hitze nach irgendwelchen Sachen zu suchen. Meine Mutter hätte das getan. So wie wir unsere Mutter kennengelernt haben, Birgit und ich, die wäre da rein marschiert und hätte ausgeräumt, was noch zu holen war.
Ich war ein Jahr später in Dresden. Da war gerade der Jahrestag der Bombardierung gewesen. Man konnte zwar die Straßen entlanggehen, aber rechts und links lagen riesige Trümmerberge. Das war sehr beeindruckend. Da hatten die Menschen, weil es der Jahrestag war, auf die Trümmer Kränze gelegt. Es waren ja Dresdens Prachtstraßen, die Prager Straße, die Seestraße, da standen früher neben Wohngebäuden auch die riesigen Kaufhäuser und da lagen überall Kränze drauf. Ein ganz merkwürdiger Geruch lag über der ganzen Stadt. Der Anblick war grausam. Alles war noch zerstört, auch das Schloss, der Zwinger und die Oper. Alles lag in Trümmern. Das hat man später sehr schnell wieder aufgebaut.
Naumburg hat auch ein paar Bomben abgekriegt, aber schlimm war vor allem, dass die ganzen Bombergeschwader, die in der Umgebung bombardierten - das Leunawerk und die anderen großen Werke waren nicht weit von uns entfernt - dass die niedrig über unsere Kasernen flogen. Es war gefährlich und vor allem in der letzten Kriegszeit waren immer Tiefflieger unterwegs, Bristol-Blenheims. Auf meinem Schulweg musste ich mich schnell verkrümeln in den Graben, wenn einer da war oder in die Büsche. Das kriegten wir eingeimpft. Es gab ein hohes Summen. Wenn man dieses Geräusch hörte, dann wusste man Bescheid, dann begab man sich sofort in Tieflage. Das war schon beängstigend.
Das Ende des Krieges
Meine Schwester wurde im Dezember 1944 geboren und sie wurde am 12. April 1945 getauft. Wir machten eine Haustaufe, denn es war alles mit Schwierigkeiten verbunden. Es waren Tiefflieger unterwegs und man konnte nicht mehr Autofahren in die Stadt und ein Bus fuhr auch nicht mehr. Mein Vater war da und etliche Ärzte und Bekannte von uns. Birgit hatte gerade ihre Taufe empfangen, da kam Panzeralarm. Dann verteilte sich alles so schnell es ging. Die Leute, die von der Stadt raufgekommen waren, sahen zu, dass sie wieder runterkamen, nur der Pastor aß noch gemütlich alles auf, was er kriegen konnte. Der ging als letzter. Da war ich schon lange im Keller. Am nächsten Tag waren die Amerikaner da. Angst haben wir vor den Amerikanern nicht gehabt.
Eine Ahnung, dass der Krieg zu Ende gehen würde, hatten wir schon vorher. Bei uns wurde manchmal etwas offener geredet, auch mit den Offizieren. Die Wehrmachtsoffiziere hatten mit den Nazis nicht viel am Hut. Ich habe gehört, wie die sich unterhalten haben und wie sie sagten: "Das ist das Ende."
Ab und zu kamen Freunde zu meinem Vater zum Essen. Der eine war Rossschlachter. Der kam mal mit 12 Steaks an, die mein Vater zubereiten sollte. In der Zwischenzeit hatte unser Hund sie gefressen. Zu der Gruppe gehörte auch der Gestapomann, ein ganz feiner Mann, der hat vielen Naumburgern zur Flucht verholfen. Als die Amerikaner kamen, ist er ihnen ganz alleine entgegen gegangen und hat sich erschießen lassen. Er hat bloß die Pistole rausgeholt. Hinterher wurde erzählt, sie wäre nicht einmal geladen gewesen.
Die Amerikaner kaElke Roßberg mit Puppenwagen in der Hubertuskaserne am Flemminger Wegmen in die Kaserne und guckten sich alles an. Es gab oben auf dem Berg zwei Kasernen, das Infanterieregiment und die Artillerie. Das waren zwei vollkommen getrennte Bereiche. Dazwischen führte die Straße nach Flemmingen. Früher hieß sie Flemminger Weg. 1939 wurde sie umgetauft in Adolf-Hitler-Straße und nach dem Krieg hieß sie wieder Flemminger Weg. So heißt sie heute noch. Flemmingen war das nächste Dorf. In der Artilleriekaserne lebten dann die Amerikaner. Einmal kriegten wir Besuch von Amerikanern, die fragten meinen Vater, wo man gute Weinbrände, Schnäpse und so etwas einkaufen könnte. Mein Vater hat erzählt, wo er einkauft. In Northeim im Harz, in der Nähe von Quedlinburg, da wäre die Spirituosenfabrik und Brennerei. Sie wollten einen Bus organisieren und mein Vater sollte mit ihnen dorthin fahren. Sie wollten für die Kaserne einiges einkaufen. Mein Vater aber sprach nur Französisch, er sprach kein Englisch. Ich konnte ganz gut Englisch und dann haben sie mich mitgenommen. Das hat mir Spaß gemacht. Ein amerikanischer Offizier fuhr mit und zwei Leute von der Mannschaft, die die Sachen schleppen sollten. Er hat sich mit mir unterhalten und hat auch gefragt, ob ich in Naumburg aufgewachsen wäre. Als ich erzählte, ich wäre in Dresden geboren, stockte er, schaute mich an und sagte: "Oh, pardon me." Das fand ich schon erstaunlich.
Von da an kamen die amerikanischen Offiziere öfter zu uns. Sie brachten Lebensmittel mit und ließen sich von Vati etwas Schönes kochen. Es entwickelte sich eine ganz nette Freundschaft mit diesen Offizieren. Sie waren nicht lange da, bis August etwa. Ich war immer mit dabei, denn ich musste ja übersetzen. Eines Tages sagten sie zu uns, dass sie abrücken würden und dass die Russen kämen. Davon hatten wir als Bevölkerung noch nichts gehört. Es wurde gemunkelt, aber wir erfuhren nichts Eindeutiges. Mein Vater erzählte, dass er von seinen russischen Kriegsgefangenen einen Brief bekommen hätte. Sie hätten ihm aufgeschrieben, dass er gut zu ihnen gewesen wäre und sie vor dem Verhungern bewahrt hätte. Falls Russen kämen, sollte er den Brief zeigen. Ein amerikanischer Offizier hat meinen Vater gefragt, ob er den Brief noch hätte, ob er ihn vorweisen könnte. Mein Vater meinte nur: "Nein, so etwas brauche ich doch nicht." Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass er den Brief nicht aufbewahren musste, als müsste eigentlich jeder wissen, dass er ein anständiger Mensch war.
Am nächsten Tag waren die Russen da. Das war ein Unterschied zwischen den Russen und den Amerikanern. Wir kriegten ja die russische Kampftruppe dahin, verlaust, verdreckt, z. T. in Fetzen gekleidet mit Fußlappen, mit ihren kleinen Panjewagen mit Pferden davor. Es war eine Katastrophe. Die amerikanischen Offiziere waren elegante, gut gekleidete, sehr zivilisierte Leute gewesen. Frau Lamberty kam mit ihren zwei Töchtern zu uns in die Kaserne und fragte, ob sie die Mädchen bei uns lassen könnte. Die wohnten mitten im Sperlingsforst, im Wald und hatten Angst. Die Mädchen sollten ein paar Nächte bei uns schlafen. Wir haben sie mit einquartiert. Muschi war ein Jahr jünger als ich und ihre Schwester war drei Jahre jünger. Wir waren gut befreundet und hatten immer zusammen gespielt. Der Vater war Schnitzer. Er hat die wunderschönen Holzschnitzereien in Naumburg gemacht.
Es dauerte gar nicht lange, dann mussten wir aus der Kaserne raus. Natürlich mussten wir die Wohnung eingerichtet verlassen. Wir zogen ins Offizierskasino mitten im Wald. Muck Lamberty wohnte genau daneben. Wir Kinder haben uns gefreut. Wir waren dann praktisch Nachbarn. Meine Eltern führten das Offizierskasino, jetzt das russische. Mein Vater hat gekocht, meine Mutter hat gearbeitet wie immer. Wir standen dann unter einem gewissen Schutz und wir konnten diesen Schutz auch weitergeben, so dass auch die Nachbarn geschützt waren. Es gab dort auch nur diese beiden Häuser, das Offizierskasino und die Villa von Lambertys. Wir hatten überall, wo wir gewohnt haben, ein Stück Garten. In der Kaserne hatten wir ein Stück entfernt, einen großen Garten, den hat mein Großvater gleich in die Hand genommen, als er kam. Mir tat am meisten leid, als wir raus mussten, dass der Pfirsichbaum gerade trug.
Im Dezember, ein paar Tage vor Weihnachten, wurde dann mein Vater abgeholt. Er wurde nicht alleine abgeholt, sondern viele Naumburger. Da war Birgit so krank, sie hatte ganz furchtbaren Keuchhusten. Sie war wirklich todkrank. In der ersten Zeit haben wir überhaupt nichts von meinem Vater gehört. Er war zuerst in Mühlberg und dann in drei oder vier verschiedenen Lagern. Die letzten zweieinhalb Jahre war er in Buchenwald. Eine Zeitlang war er wohl im gleichen Lager wie Heinrich George. Der hatte dort eine Theatergruppe aufgemacht. Birgit erzählt, er habe später über die Zeit gesprochen. Ich war, als er 1950 nach Hause kam, nur noch vier Monate da. In dieser Zeit erzählte er noch nichts.
Es gab einen kurzen Zettel. Wir wussten dann, dass er in Mühlberg war. Aber von ihm selber haben wir das nicht gehört. Wir kriegten auch mal aus Buchenwald einen Zettel. Man hat manchmal, wenn Leute entlassen wurden, etwas gehört.
Schule, Schwarzmarkt und keine Uniform
Inzwischen hatte die Schule wieder angefangen. Davon war ich nicht begeistert. Ich musste ja von oben den ganzen Weg runter in die Stadt. Ich ging eigentlich schon in die zweite Klasse im Lyzeum. Wir hatten bereits Englisch und Latein. Mit Schulbeginn kriegten wir sofort Russisch als dritte Sprache dazu. Englisch und Latein blieben uns aber erhalten. Auf die Art und Weise habe ich von 1945 bis 1950 Russisch gelernt. Die Schule war durch den Krieg ungefähr ein halbes Jahr ausgefallen. Wir konnten eine Prüfung machen und wer die schaffte, kam praktisch gleich in die nächste Klasse. Ich kam also auf dem Lyzeum gleich in die Quarta. Es gab Doppelstunden. Wir hatten von morgens um 8 bis mittags um 2 Uhr Schule. Da hat kein Mensch danach gekräht, ob man das aushalten konnte. Es gab wenig zu essen. Von den Amerikanern angeregt kriegten wir Milch. Das ging auch bei den Russen weiter. Eine Zeitlang gab es auch eine Schulspeisung, Milchsuppe, aber nicht lange. Wir hatten kein Papier, um darauf zu schreiben. Es gab Zeitungen, z. B. das Neue Deutschland. Wir haben z.T. auf Zeitungspapier geschrieben, auf die Ränder. Bücher gab es auch keine, infolgedessen haben wir alle Stenographie gelernt, so dass wir im Unterricht mitstenographieren konnten und zu Hause haben wir die Inhalte dann auf irgendwelches Papier geschrieben. Also haben wir unsere Schulbücher praktisch selber geschrieben. Das ging 2 bis 3 Jahre so, bis es sich etwas besserte. Ich muss ja sagen, wenn ich das Gejammer höre mit dem Abitur in 12 Schuljahren. Das gab es in der DDR gar nicht anders und unsere Allgemeinbildung, die war viel besser als heute. Ich finde das manchmal erschreckend. Die Leute sind doch nicht dümmer geworden. Wir hatten natürlich nicht so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Ich ging allerdings, nachdem ich konfirmiert war, auch in die Tanzstunde. Ich musste aber über 30 Jahre alt werden, bevor ich einmal ohne männliche Begleitung ein Lokal betreten habe. Das gab es nicht. Man kriegte eine Einladung und man wurde abgeholt. Die Mutter kriegte einen Blumenstrauß. Das war selbstverständlich. Mit der Gleichberechtigung und dem Verhältnis der Geschlechter zueinander waren wir in der SBZ und in der DDR weiter als im Westen. Bei uns ging man normal miteinander um, so wie das auch heute der Fall ist. Im Westen gaben noch die Männer den Ton an. Als ich später auf Sylt im Frauenchor war, gab es einmal eine Wahl. Wir haben darüber gesprochen und ich habe meine Meinung kundgetan. Und eine Frau sagte: "Ich wähle selbstverständlich das, was mein Mann wählt." Ich meinte dazu: " Hast du denn keine eigene Meinung?" Solche Sachen fielen mir auf. Vielleicht waren die Leute auf der Insel oder in Schleswig-Holstein auch besonders rückständig. Man sagt ja, das waren die "prüden" Jahre, die erst durch die 68er abgeschafft wurden. In der Beziehung waren wir in Mitteldeutschland 20 Jahre voraus.
Meine Mutter konnte sich immer durchschlagen, auch mit uns alleine. Sie hat das immer irgendwie geschafft. Sie hat ordentlich nebenbei schwarz gehandelt. Ich weiß nicht, ob sie sich manchmal über ihre ängstlichen Kinder geärgert hat. Für mich war das ein Graus, diese Sachen machen zu müssen. Der Vater sitzt schon irgendwo im KZ und ich selber musste mit geschmuggelten Sachen herumziehen. Das waren Hausbrände, Kartoffelschnaps und so etwas. Wir wohnten dann unten in der Stadt, weil wir aus dem Offizierskasino auch raus mussten. Wir hatten eine kleine Stadtwohnung und Mutti arbeitete oben. Wir hatten dort auch Telefon. Mutti rief an und sagte: "Bring mal drei Stück rauf." Das hieß dann nur "Stück". Das waren diese komisch geformten Literflaschen. Mehr ging nicht rein. "Bring mal drei Stück und setz das Kind drauf." Die Kinderkarren waren damals noch niedrig mit kleinen Rädern. Die waren nicht gerade stabil. Meine Oma half mir. Die packte die Flaschen rein. Dann kam ein Kissen drauf und eine Decke. Und obendrauf kam Birgit - sie muss so zwei gewesen sein - die rutschte und wurde festgeschnallt. Dann musste ich den Berg hoch und die Flaschen ins Kasino transportieren. Ich war ja schon recht ansehnlich. Für mich war das nicht leicht, wenn du unterwegs dauernd angemacht wirst von Russen. Ich bin wütend angekommen und dann bin ich mit dem Kind tieferliegend in der Karre wieder nach unten.
Ich hatte zu der Zeit noch Klavierstunden. Unser Klavier war allerdings eingelagert. Wir konnten das Klavier in Naumburg in der kleinen Wohnung nicht aufstellen. Später hatten wir es dann in der Hopfenblüte im Vereinszimmer. Ich sollte immer zu einer Bekannten von meiner Mutter, die auch für uns genäht hat, zum Klavier üben. Sie kriegte dafür Essen, denn wir kamen ja durch Muttis Arbeit ganz gut an Nahrungsmittel ran. Aber wenn du als Kind bei irgendwelchen Leuten Klavier üben sollst… Die Übungen sind ja nicht immer so hörenswert. Du musst ja Übungen machen und spielst keine Stücke, also das hatte keinen Zweck mehr. Dann hat es sehr lange gedauert, ehe ich wieder ein Klavier hatte.

Die russische Besatzungszeit war eine unruhige Zeit. Ich durfte weg, auch zum Tanzen, aber ich musste immer Bescheid sagen, man wusste immer, wo ich war. Wir hatten auch immer ein Telefon und auch bei meinen Freundinnen gab es meistens ein Telefon. Wir konnten immer Bescheid geben, ob wir gebracht werden oder ob wir abgeholt werden sollten. In so einer Zeit musste man das wissen. Aber sonst konnte man tun, was man wollte. Ich war in verschiedenen Vereinen und Clubs. Im Ruderclub und im Kulturverein. Da ging ich schon hin, damit ich nicht in die FDJ brauchte. Dann hatte ich die kirchliche Spielgruppe mit den Krügers, Klaus Krüger und seiner Schwester Helga. Ich war nie in der FDJ. Ich habe nie viel Dienstkleidung getragen. Beim BDM nur in der ersten Zeit in Naumburg und in der Nachkriegszeit wollte ich mir das absolut nicht angewöhnen. Ich hatte kein Blauhemd. Ich war die einzige. Das ist mir nicht immer gut bekommen. Die Zeit wurde dann auch anders, als die Leute kamen, die angeblich mit den Nazis nichts zu tun gehabt haben, obwohl man ja in der Kleinstadt ganz genau gewusst hat, dass sie es doch hatten. Erst die große Klappe vorher und hinterher genauso.
1950 - Hopfenblüte und Flucht
Mein Vater war die ganzen Jahre mit einem seiner Kollegen, dem Wirt aus der Waidmannsruh, zusammen im Lager gewesen. Der Hoffmann aus der Waidmannsruh hatte einen Sohn und mein Vater eine große Tochter und so wurden wir in ihren Gedanken miteinander verheiratet. Werner war aber 10 Jahre älter als ich. Er war schon im Krieg als Soldat gewesen. Wir beide, Werner Hoffmann und ich, haben unsere Väter dann vom Bahnhof abgeholt, als sie aus Buchenwald entlassen wurden. Meine Mutter konnte ihn nicht abholen. Wir wussten, dass die Väter diese Pläne hatten, aber Werner war schon verlobt und das wurde erst mal verheimlicht. Wir sind sogar mal zusammen ausgegangen. Nur um unsere Väter nicht aufzuregen. Die kamen ja beide ziemlich krank zurück. Mit der Zeit mussten wir ihnen dann mitteilen, dass wir nicht die Absicht hatten, etwas miteinander anzufangen. Wir konnten uns trotzdem gut leiden. Ich habe von Werner die Lateinkladden bekommen. Er hatte uralte Übersetzungen aus dem 19. Jahrhundert. Wir kriegten die Lehrer vom Jungengymnasium an unsere Schule. Herr Dr. Dr. Meier, Latein und Geschichte, meinte eines Tages, er würde jede Kladde kennen: "Aber bei Ihnen, Rataj komme ich nicht klar. Entweder sie können das tatsächlich, oder sie haben eine Übersetzung, die mir noch nicht untergekommen ist." Ich war nicht schlecht in Latein, ich übersetzte auch ziemlich wörtlich, aber natürlich benutzte ich die Übersetzungen. So hat mir Werner geholfen und wir waren auch mal tanzen zusammen, als unsere Väter gerade gekommen sind, aber da war seine Freundin mit dabei. Das wussten die Väter natürlich nicht.
Meine Eltern konnten dann die "Hopfenblüte" pachten, ein Lokal an der uralten Stadtmauer von Naumburg. Wir haben vorher schon immer die Biere vor Ort bezogen und die Weine, viel Saale-Unstrutwein und auch Sekt. Die Sektkellerei in Freiburg, wo wir Weine und Sekt bezogen haben, hieß Kloss und Förster. Die sind dann nach Westdeutschland gegangen. Damals lebte die alte Frau Kloss noch und die hatten verschiedene Gaststätten. Das war so üblich, dass ein Weingut auch Gaststätten hatte und so konnten meine Eltern die Gaststätte pachten, das ganze Haus mit Vereinszimmer und Kegelbahn und Wohnung. Die Anfänge habe ich noch mitgekriegt und dann war ich zweimal zu Besuch, bis ich ein für die Deutsche Demokratische Republik "unwürdiges Subjekt" wurde. Dann durfte ich nicht mehr hin. 1954 und 1955 war ich noch dort. Das erste Mal noch mit Uta alleine und das zweite Mal war auch Anke schon unterwegs. Ich kannte Frau Kloss von früher. Es gab also damals schon den Rotkäppchensekt und Saale-Unstrut-Weine. Meine Eltern waren nicht in der HO und auch nicht beim Konsum, denn sie wollten sich nicht organisieren lassen. Dadurch wurde mein Vater nicht mehr beliefert. Er kriegte sozusagen das, was übrig war. Und da haben meine Eltern sich auf - heute würde man sagen "Naturkost" - spezialisieren müssen. Es gab Salate, Eierspeisen, auch mal Fleisch und Fisch und vor allem Pilzgerichte. Die Anfänge waren nicht so einfach. Wir haben alle nicht so den Drang gehabt, uns irgendwelchen Vereinigungen anzuschließen. Meine Eltern haben sich auch mit Erfolg bemüht, keine Ämter in der Öffentlichkeit zu übernehmen. Die wollten sie gerne haben, auch meinen Vater als Schützenkönig, aber da hat er immer abgelehnt, genau wie meine Mutter in der Frauenschaft. Sie hat immer gesagt, zu solchen Sachen hätte sie keine Zeit, sie wäre genug kriegsdienstlich eingesetzt, sie müsste die verwundeten Soldaten betreuen.
Ich bin praktisch bei Nacht und Nebel weggegangen. Ich habe mir mein Zeugnis noch geben lassen und habe dann zu Hause gesagt: "Ich fahre nach Sylt." Nicht, dass ich nicht wiederkommen wollte. Ich habe mich sozusagen einfach mit meinem Koffer in Marsch gesetzt. Ich hatte vorher ein Gespräch mit unseren zwei Schuldirektoren. Die hatten mich - nicht mich alleine, sondern auch noch eine Freundin - zu sich bestellt. Ihr Onkel war zu der Zeit Bürgermeister in Naumburg und die wohnten auch zusammen. Wir wurden beide hinbestellt, wurden einzeln rein gerufen und kriegten ungefähr das gleiche zu hören. Zu der Zeit wurden nur Ingenieure und Ärzte gebraucht und etwas anderes durfte auch nicht studiert werden. Weil wir keine Arbeiter- und Bauernkinder wären, müssten wir etwas dafür tun, um studieren zu dürfen. Wir sollten erst mal auf dem Bau arbeiten und anschließend Ingenieur werden oder Krankenschwester oder medizinische Assistentin werden, um dann vielleicht zum Medizinstudium zugelassen zu werden. Wir hatten sozusagen Fachabitur und man musste dann schon entscheiden, was man machen wollte. Sie wollten auch, dass wir Spitzeldienste machten. Inge Becker hatte man gedroht, da ihr Onkel Bürgermeister wäre - ihr Vater lebte nicht mehr, der war wohl gefallen - müsste sie sich besonders anstrengen. Mir hat man gesagt, mein Vater wäre ja gerade aus dem KZ gekommen und könnte genauso schnell wieder reinkommen. Dann hat man uns ein Schreiben vorgelegt. Wir sollten unterschreiben und nach diesen Worten haben wir das natürlich auch getan. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, so das war's. Hier musst du weg, weil ich das ja nun absolut nicht wollte. Bei meinen Eltern verkehrten auch Leute, die dem damaligen System in der SBZ nicht genehm waren. Und die auszuspionieren kam für mich natürlich überhaupt nicht in Frage. Da habe ich mich in der gleichen Nacht in den Zug gesetzt und bin abgehauen. Ich kriegte allerdings von einem Schulkameraden, der zur Stadt-FDJ gehörte - wir haben ihn immer "Oma" genannt, weiß der Deubel, warum - ein paar Tage vorher eine Warnung. Der sagte: "Du Elke, es wäre besser, wenn du dich dünne machst." So hat er sich damals ausgedrückt. Wir haben ziemlich offen rebelliert, also uns passte das ganze System nicht. Uns hat es vorher nicht gepasst und jetzt passte es uns schon gar nicht mehr. Wir wollten Freiheit. Wenn du gesagt bekommst, du kannst nur das eine machen. Ich wollte ja damals schon Geschichte und Archäologie studieren. Das kam auch durch meinen tollen Geschichtslehrer, Dr. Meier. Mein Lebenstraum war, irgendwo still und leise in Ägypten oder anderswo zu sitzen und im Sand zu buddeln. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Und wenn du dann zu hören kriegst, du kannst entweder Ingenieur werden oder vielleicht Medizin studieren. Ich hatte zu beidem absolut keine Lust. Ich wollte das nicht und vor allem - das war wohl der Hauptgrund - wollte ich mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu lassen hatte. Das war ich mein Leben lang nicht gewöhnt.
Meine Fahrt war sehr abenteuerlich. Ich bin ziemlich unbedarft an die Grenze gekommen, habe mich dort erst mal umgesehen und erkundigt und fand andere, die den gleichen Weg vorhatten, von Hötensleben nach Schöningen. Das war im Harz, irgendwo bei Helmstedt. Zwischen den beiden Dörfern war ein kleiner Fluss. Wenn man den Fluss überwunden hatte, war man auf der anderen Seite. Zu der Zeit gab es noch keinen Zaun. Es war eher ein Bach, durch den man musste, etwa 5 Meter breit. Jeden Tag gingen da Gruppen durch. Einer führte unsere Gruppe am helllichten Tag. Zu der Zeit ging man noch ziemlich unbedarft rüber. Kurz bevor wir an der Grenze ankamen, wurden wir von Russen geschnappt. Die brachten uns zurück und sperrten uns den Tag über ein. Da mussten wir Küchendienst machen. Ich musste Bohnen putzen. Am Abend kriegten wir eine Verwarnung und sollten zusehen, dass wir nach Hause kamen. Das wollte natürlich keiner, also haben wir uns wieder in kleineren Gruppen zusammengefunden und sind diesmal im Dunkeln los. Wir sind durch den Fluss gewatet. Ich war todmüde. Man ging ja noch nicht in Hosen. Ich hatte so ein kleines Kostüm an und habe meinen Koffer hinter mir hergezogen. Alles war sehr nass. Wir kamen auf ein Feld und sind einfach weitergelaufen bis uns ein Wagen entgegen kam. Das waren westdeutsche Grenzpolizisten. Die haben uns mitgenommen und gaben uns etwas zu trinken und sie meinten, wir sollten einen Lastwagen anhalten. Es würden dort Fernfahrer unterwegs sein. Wir hielten einen Lastwagen an, der lud die Leute hinten drauf, ich sollte mit vorne sitzen. Der Fahrer wurde dann später sehr "freundlich", so dass ich mich lieber mit nach hinten setzte.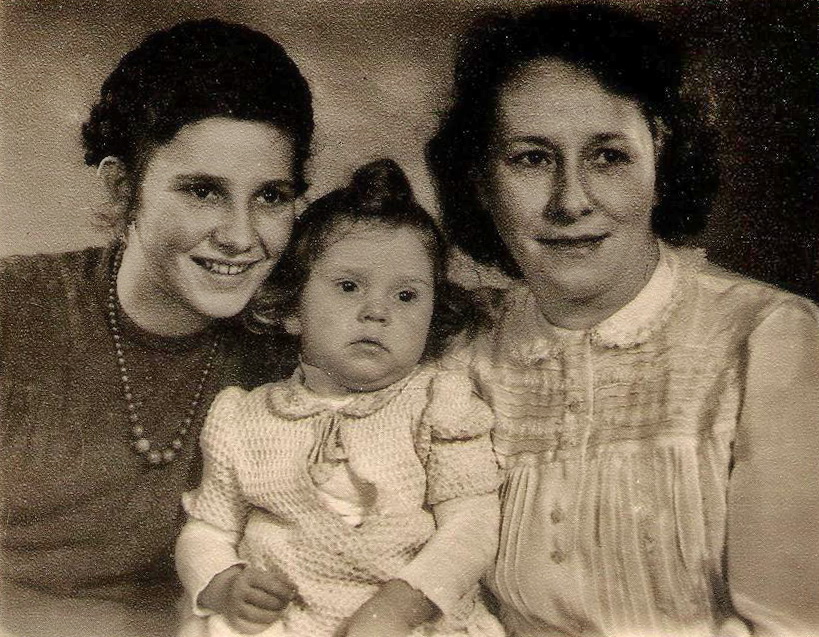
In Bremen wurde ich auf dem Marktplatz abgesetzt und dann habe ich mich durchgefragt, bis ich zum jüngsten Bruder meiner Mutter, Onkel Hansi und seiner Frau Annegret kam. Die beiden hatten eine Tochter, die etwa 4 Jahre alt war. Ich blieb dann ein paar Tage und wollte eigentlich per Anhalter weiter. Ich hatte nicht mehr so viel Geld, weil ich einiges für die Lastwagenfahrt losgeworden war. Aber sie bestanden darauf, dass ich mit dem Zug weiter nach Hamburg fuhr zu meiner Patentante, Tante Inge. Von dort bin ich mit dem Zug nach Sylt gefahren.
